Ein wunderschöner Tag am Pool, die Sonne scheint, in der linken Hand einen Cuba Libre. Ein wunderbarer Moment, den man genießen sollte. Doch immer mehr Menschen zerstören solche unmittelbaren Glücksmomente, indem sie ihr Smartphone zücken, um das perfekte Foto zu schießen – während der magische Augenblick vorbeizieht. Beim Versuch, das Glück zu intensivieren, verlernen wir, es direkt zu erleben. Wir sprachen mit der Psychologin, Autorin und Professorin für Wirtschaftspsychologie Sarah Diefenbach über das Seelenleben der Generation Smartphone und über die Auswirkungen der Coronapandemie auf unser soziales Miteinander.
Frau Prof. Diefenbach, einfache Frage vorab: Was macht uns glücklich?
Eine große Frage gleich zu Beginn! (lacht!) Man kann da zwischen den einzelnen Glücksmomenten und einer vielleicht eher überdauernden Lebenszufriedenheit differenzieren. Das ist in der Glücksforschung sehr interessant, wie man fragt und wie sich dann die Ergebnisse unterscheiden. Man kann, wenn man die Ansätze diverser Bedürfnistheorien zu Rate zieht, zurückgehen auf die psychologischen Grundbedürfnisse.

Wie zum Beispiel die Bindung oder Verbundenheit: sich anderen Menschen nah zu fühlen, eingebunden zu sein. Kompetenz: das Erlebnis, dass man in einer Sache besser wird und etwas bewegen kann. Ein Stück Selbstwirksamkeit oder Selbstwert spielt da eine große Rolle. Autonomie oder Selbstbestimmung: Dinge eigenständig entscheiden und gestalten zu können. Dann aber auch ein Stück Sicherheit und Verlässlichkeit: das Leben unter Kontrolle haben. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Im Prinzip sind es diese Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, dass daraus Glücksmomente entstehen können. Nicht alle gleichzeitig, aber sie sind alle für sich Quelle für Glück. Ich denke, wenn man seinen eigenen Alltag betrachtet und sich fragt: „Was hat mich gestern glücklich gemacht?“, dann hat oft die Erfüllung eines oder mehrerer dieser Grundbedürfnisse eine Rolle gespielt.
Dazu zählen natürlich auch körperliches Wohlbefinden und Lust, Momente des Genusses und sinnliche Erfahrungen. Auch die sind Quelle von Glücksmomenten.
…
Über ein Jahr lang lebten wir durch die Coronapandemie mit auferlegten Kontaktbeschränkungen. Sehr viele Menschen bekamen psychische Probleme. Besteht nicht die Gefahr, dass wir uns noch mehr in die digitale Smart-Welt zurückgezogen haben oder noch zurückziehen? Welchen Einfluss und emotionale Auswirkungen hatten die Coronamaßnahmen auf unser Medien-Nutzungsverhalten?
Medien – also auch Kommunikationsmedien als Kanal zu anderen – sind natürlich zu Coronazeiten noch einmal relevanter und damit auch spannender geworden. Einerseits zeigen sie gerade ihr Potenzial – es wird uns klar, wie stark wir auf diese Kanäle angewiesen sind, um das Gefühl zu haben, weiter im Austausch zu sein und von anderen mitzubekommen. Das ist ja auch sehr wertvoll.
Ich weiß nicht, ob man mutmaßen könnte, dass, wenn es diese Möglichkeiten noch nicht gegeben hätte, die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen noch viel dramatischer gewesen wären.
Gleichzeitig zeigt es aber auch viel deutlicher, was sich nicht digital ersetzen lässt. Das ist ein Thema, das wir gerade auch im Arbeitskontext erfahren. Es wird sehr viel auf digitale Meetings umgestellt. Wir haben da gerade eine Studie laufen, die zeigt, wie unglücklich es macht, wenn der beiläufige Austausch fehlt. Das, was sich beim Mittagessen im Team oder am Abend nach Konferenzen an Kreativität und Austausch von neuen Ideen ergibt, ist wirklich sehr schwer zu ersetzen. Man wird reduziert auf die Essentials des Arbeitsgebiets. Ich habe schon von Leuten gehört, die jetzt ihren Job wechseln wollen, weil sie nach dem Wegfall von sozialem Austausch ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr so spannend finden.
Insofern glaube ich, dass wir jetzt nach der Pandemie den direkten Kontakt und den Austausch noch mehr zu schätzen wissen. Unser gesamtes Leben wurde digital: vom Arbeiten bis hin zum Sport treiben. Jetzt werden wir überlegen und entscheiden müssen, was wir beibehalten und was wir wieder so wie vorher gestalten. Aber insgesamt verfängt man sich immer mehr in der virtuellen Welt.
Das Gute war, es gab nichts Aufregendes zu posten oder zu teilen.
Absolut! Das war ein positiver Effekt, dass die sozialen Medien gerade in der Anfangszeit der Pandemie einen guten Kanal geboten haben für dieses Gemeinschaftsgefühl. Etliche haben sich lustige Aktionen einfallen lassen, wie man dem begegnen könnte. Es war vielleicht auch ein bisschen Beschäftigungstherapie, weil viele Leute nicht wussten, was sie mit ihrem Tag anfangen sollten.
Je länger es dauerte, desto mühsamer und desillusionierender wurde die Situation. Das Gefühl „Wir befinden uns in einem Survival Camp, und wir kommen da schon irgendwie durch“ ist weg. Es steht auch niemand mehr auf dem Balkon und klatscht. Es wird nicht mehr gemeinsam musiziert. Es hat eine Ernsthaftigkeit bekommen, wie man sich der Situation stellen kann und das Leben gestaltet.
Vielleicht war die Phase der Pandemie auch eine gute Schule für die Social Media Hardcore User. Die extensive Nutzung von Smartphones im täglichen Leben hat bedenkliche Auswirkungen auf unser Miteinander. Als Psychologin nennen Sie das soziale Normkonflikte. Was verstehen Sie darunter?
Soziale Normen sind grundsätzlich unausgesprochene Regeln des Miteinanders – in unserem Alltag und für unser Funktionieren als Gesellschaft. Das gab es schon am Lagerfeuer unserer Vorfahren. Im Kontext unseres komplexen Alltags kommen wir oft in Situationen, die erst durch Technik ermöglicht werden, für die es noch keine ausgehandelten Verhaltensregeln gibt. Da prallen oft unterschiedliche Ansichten darüber, was angemessen ist und was nicht, aufeinander. Die Ansichten entwickeln und verändern sich über die Zeit. Während ein Handy auf dem Esstisch früher möglicherweise Bewunderung ausgelöst hat, wird die Nutzung des Smartphones am Esstisch heutzutage als sehr unhöflich empfunden. Wenn man sich im Café oder im Restaurant gegenübersitzt, dann sollte man auch seinem Gegenüber die Aufmerksamkeit schenken. Trotzdem ist das ein typischer Fall dafür, dass es noch unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was richtig und was falsch ist. Es gibt Menschen, die sagen, das sei doch ganz normal – ein Handy gehöre einfach dazu. Was bedeutet das aber für sein Gegenüber? „Du allein bist mir nicht wichtig genug. Es kann jederzeit sein, dass da was Wichtigeres reinkommt. Dem wende ich mich dann auch ganz automatisiert zu.“
Studien zeigen, dass allein ein Handy auf dem Tisch als Signal die Gesprächsatmosphäre negativ beeinflusst.
Normkonflikte gibt es in vielen Bereichen – auch jetzt im Kontext digitaler Meetings. Für Zoom- oder Teamssitzungen gibt es noch keine abgesprochenen sozialen Normen. Was überträgt man von den nicht digitalen Meetings in die digitalen? Wenn ich in der digitalen Sitzung kurz ein Glas Wasser trinken möchte oder auf die Toilette muss, kann ich einfach aufstehen und leise gehen oder sollte ich mich entschuldigen und von den anderen verabschieden, bevor ich den Platz am Monitor verlasse? Gehört es sich überhaupt, die Kamera anzuhaben? Was ist, wenn einzelne die Kamera nicht nutzen? Das gibt eine unangenehme Atmosphäre, wenn man einzelne schwarze Kacheln im Zoom-Tableau sieht. Fordert man die Verweigerer dazu auf, die Kamera anzustellen? Wie sieht es aus mit der Pünktlichkeit?
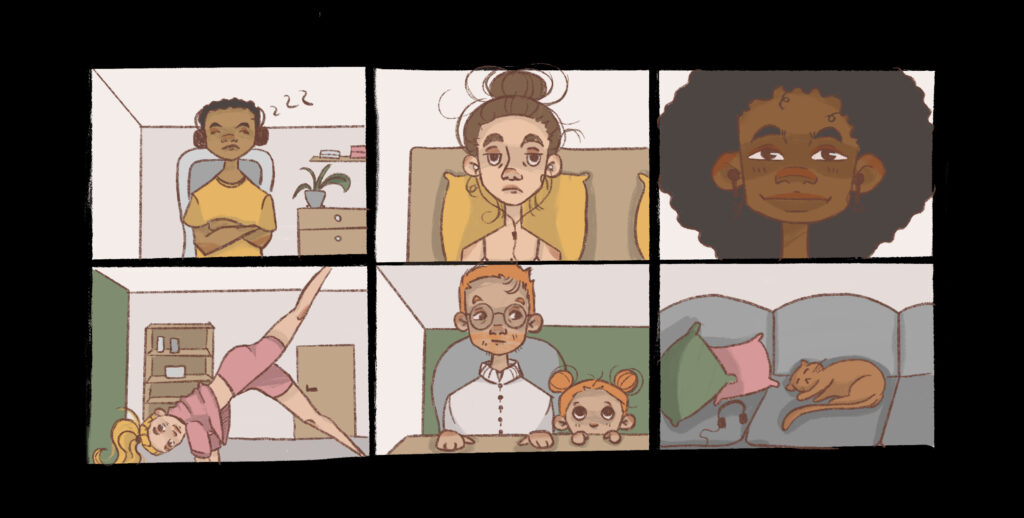
Das sind alles Themen – und das haben wir in unserer Studie auch festgestellt –, die bewirken können, dass Teams auseinanderfallen und nicht mehr produktiv arbeiten können. Man fühlt sich nicht mehr wirklich im Austausch. Wenn diese Konflikte unbemerkt bleiben, kann es gefährlich werden. Der Fokus liegt auf den technischen Strukturen. Die Anleitung aber, wie man über die Strukturen das Miteinander gestaltet, wird nicht so leicht bereitgestellt. Das Fehlen der Normen kann immens negative Auswirkungen haben.
Richtig! Es gibt inzwischen schon Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet, die sogenannte Netiquette. Dieses Regelwerk ist durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt noch um weitere Normen zu ergänzen. Es gibt allerdings noch weitere Gründe, seinen Medienkonsum zu beobachten. Viel zu oft kann man beobachten, wie Mütter oder Väter den Kinderwagen schiebend ihre Mails auf dem Handy checken, wie stillende Mütter die Timeline in Facebook durchstöbern oder wie Väter auf dem Spielplatz nebenbei in WhatsApp-Gruppen plaudern. Jede noch so kleine Unterbrechung oder Ablenkung stört in den ersten Monaten und Jahren die Bildung einer existenziell wichtigen Bindung zwischen Mutter – respektive Vater – und Kind. Ich denke, den meisten sind die Gefahren für die gesunde Bindungsentwicklung nicht bewusst, oder?
Absolut! Das ist eins von meinen Lieblingsaufregerbeispielen. Schon bevor ich selbst Mutter geworden bin, hat mich das Verhalten von einigen Eltern sehr erschreckt und geärgert. Es ist traurig, solche Szenen zu sehen, wo im Bus die Kleine ihre Mama mit Blicken sucht und Aufmerksamkeit braucht und die Mutter in ihrem Smartphone zu versinken scheint. Kinder machen uns viel bewusster, was man tatsächlich tut und wie hart der Kontaktabbruch mit der Wirklichkeit ist. Natürlich kommt es auch bei mir vor, dass ich mal in Anwesenheit von meinem zweijährigen Sohn telefonieren muss. Ich versuche aber, bewusst zu kommunizieren und zu vermeiden, dass das Handy so ein ständiger Aufmerksamkeitskiller ist, der uns immerzu begleitet. Mein Sohn hat auch schon einmal zu mir gesagt: „Mama, Handy weg!“ Natürlich gibt einem das zu denken, und für viele kann das ein Augenöffner sein. Auch bei unseren erwachsenen Mitmenschen wirkt es so, als wenn wir uns respektlos in eine Parallelwelt zurückziehen. Aber das wird nicht immer so klar kommuniziert wie von meinem Sohn. (lacht)
Ergebnisse von empirisch angelegten Untersuchungen zeigen, dass wir durchschnittlich 2,5 Stunden täglich mit unserem Handy verbringen. Die Menthal Balance Studie von Prof. Alexander Markowetz zeigt auch, dass wir im Durchschnitt 88-mal am Tag auf unser Handy schauen. Das heißt alle 18 Minuten. Um sich von dieser Unterbrechung wieder fokussiert dem zuzuwenden, was wir eigentlich tun, brauchen wir bis zu sechs Minuten. Leicht zu errechnen, wie wenig intensive Zeit uns bleibt, um in unserem Fall achtsam mit unserem Baby zu sein.
Richtig! Das sind die gleichen Zahlen, die auch im Arbeitskontext genannt werden. Auch da ist es so, dass ich nach einer Unterbrechung wieder acht Minuten brauche, um wieder genauso effektiv wie vorher arbeiten zu können. Wir haben es mit ständigen Unterbrechungen durch die verschiedensten Kanäle und Situationen zu tun. Am Bildschirm ploppt eine Meldung hoch, dass eine Mail gelesen werden will. Mein Smartphone meldet eine SMS, und die Büronachbarin schaut zur Tür herein und fragt, ob wir gemeinsam Mittag machen. Aber ganz klar, auf der Ebene des Miteinanders und gerade auch der Bindungsebene ist das genauso.
Wenn ich einen Freund verprelle, ist das wahrscheinlich nicht so existenziell, als wenn ich die Bindung zu meinem Kind zerstöre. Das ist eine grundsätzlich andere Qualität.
Na klar, das ist eine andere Qualität! Grundsätzlich konfrontiert uns das aber auch mit unseren begrenzten Fähigkeiten. Wir können nur eine Sache zur gleichen Zeit tun! Selbst, wenn mich etwas gedanklich beschäftigt, ich ein Problem von der Arbeit mit nach Hause bringe und gleichzeitig aber mit meinem Sohn Eisenbahn spiele, auch dann bin ich ja manchmal nicht ganz bei der Sache. Das Smartphone aber, das ständig dabei ist und immerzu Töne von sich gibt – wie so ein Abo auf Unterbrechung –, zerstört den Fluss von dem, was wir gerade mit ganzem Herzen und voller Aufmerksamkeit tun wollen.
Das ist eine zentrale Herausforderung, der man sich stellen muss. Wie gestalte ich mein Umfeld? Welche Unterbrechungen sind wirklich wichtig, welche lasse ich zu? Ich habe immer Verständnis dafür, dass es Momente oder Notfälle gibt, in denen man erreichbar sein muss. Aber es lässt sich konfigurieren, welche Kontakte zu welchem Zeitpunkt durchkommen und stören dürfen.
Schon ohne Corona waren die sozialen Medien sehr präsent. Während der ersten Monate der Coronapandemie machte Clubhouse auf sich aufmerksam – ein Riesen-Hype. Welche Veränderungen in der Medienwelt werden wir mit Corona erleben?
Clubhouse kann als Beispiel für Chancen neuer Formate gelten, die durch Corona befeuert werden. Wir waren alle daheim, allein vor dem Rechner oder dem Smartphone. Das war die Bedingung für einen sozialen Kanal, über den Diskussionen und Gespräche stattfinden konnten. Natürlich muss man sehen, wie sich so ein Kanal weiterentwickelt. Ob sich Clubhouse hält und wirklich Bedürfnisse befriedigen kann, auch wenn wieder gelockert wird, muss man sehen.
Was wir mit Corona gelernt haben, ist einzuschätzen, über welche Medien wir unsere Kommunikation aufrechterhalten, welche Treffen oder Meetings digital stattfinden können und welche nicht. Wir erkennen, was sich nicht eins zu eins digital übersetzen lässt. Auch in Forschungsprojekten zeigt sich, wie sinnvoll es ist, sich wenigstens ein bis zwei Mal im Jahr real zu treffen. Man möchte auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es dem anderen geht, wie das Feeling im Projekt ist. Es reicht nicht, die To-dos durchzugehen und Aufgaben zu delegieren. Die Qualität des Sozialen, aber auch der weiterführenden Gedanken ist anders.
Frau Prof. Diefenbach, vielen Dank für das Gespräch.